Neuerscheinung: Exploring Assur — Volume 2
Assur 2024. Continuing the excavations in the New Town and other research across the site
30.06.2025
Karen Radner — Andrea Squitieri (eds.)
Weitere Informationen beim PeWe-Verlag finden Sie hier.
Um die Open-Access-Version herunterzuladen, klicken Sie hier.
Dieser zweite Band der Reihe „Exploring Assur“ präsentiert die Ergebnisse der Feldforschungen und Analysen des Assur Excavation Pproject von 2024 in Assur, dem heutigen Qal’at Sherqat, vor allem in dessen Neustadt. Herausgegeben von Karen Radner und Andrea Squitieri, enthält das Buch Beiträge von Mustafa Ahmad, Mark Altaweel, Silvia Amicone, Alessandra Cellerino, Katleen Deckers, Eileen Eckmeier, Kay Ehling, Jörg Fassbinder, Rafał A. Fetner, Enrico Foietta, Eduardo Garzanti, Helen Gries, Veronica Hinterhuber, Doğa Karakaya, F. Janoscha Kreppner, Marta Lorenzon, John MacGinnis, Alessio Palmisano, Jana Richter, Jens Rohde, Claudia Sarkady, Michaela Schauer, Poppy Tushingham, Melis Uzdurum und Marco Wolf.
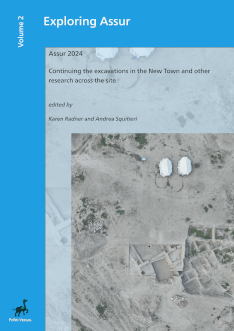 Neue Informationen, darunter 15 weitere Radiokarbondatierungen, werden für den Parther-zeitlichen Friedhof, das hellenistische Gebäude A und das neuassyrische Gebäude B aus dem Schnitt NT1 präsentiert. Der neue Schnitt NT2 brachte einen Entwässerungsschacht für das Ab- und Regenwasser der gesamten Neustadt ans Licht, der während ihrer ersten Errichtung in der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. durch den anstehenden Fels geschlagen wurde. Dieser Schacht wurde bis zum Ende der assyrischen Besiedelung der Stadt genutzt und instand gehalten. Eine auf 770–541 v. Chr. datierte Holzkohleprobe kann als Eiche (Quercus) identifiziert werden, ein Import nach Assur. Eine Tonscherbe trägt eine fragmentarische neuassyrische Keilschriftinschrift, die sich in drei Zeilen vom Rand bis zum Boden des Gefäßes erstreckt; der Text ist weder eine Widmung noch ein Eigentumsvermerk, obwohl er eine Einzelperson namentlich erwähnt sowie eine Gruppe mit ihr verbundene Personen. Nach dem Untergang des Assyrischen Reiches füllte sich der Schacht bis zum Ende der parthischen Besiedlung von Assur allmählich, insbesondere mit Werkstattabfällen aus der Metall- und Keramikproduktion. So verfügen wir über eine gut stratifizierte Keramikabfolge für die zwei Jahrtausende lange Besiedelung der Neustadt.
Neue Informationen, darunter 15 weitere Radiokarbondatierungen, werden für den Parther-zeitlichen Friedhof, das hellenistische Gebäude A und das neuassyrische Gebäude B aus dem Schnitt NT1 präsentiert. Der neue Schnitt NT2 brachte einen Entwässerungsschacht für das Ab- und Regenwasser der gesamten Neustadt ans Licht, der während ihrer ersten Errichtung in der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. durch den anstehenden Fels geschlagen wurde. Dieser Schacht wurde bis zum Ende der assyrischen Besiedelung der Stadt genutzt und instand gehalten. Eine auf 770–541 v. Chr. datierte Holzkohleprobe kann als Eiche (Quercus) identifiziert werden, ein Import nach Assur. Eine Tonscherbe trägt eine fragmentarische neuassyrische Keilschriftinschrift, die sich in drei Zeilen vom Rand bis zum Boden des Gefäßes erstreckt; der Text ist weder eine Widmung noch ein Eigentumsvermerk, obwohl er eine Einzelperson namentlich erwähnt sowie eine Gruppe mit ihr verbundene Personen. Nach dem Untergang des Assyrischen Reiches füllte sich der Schacht bis zum Ende der parthischen Besiedlung von Assur allmählich, insbesondere mit Werkstattabfällen aus der Metall- und Keramikproduktion. So verfügen wir über eine gut stratifizierte Keramikabfolge für die zwei Jahrtausende lange Besiedelung der Neustadt.
In Schnitt NT1 kamen weitere Bestattung des Parther-zeitlichen Friedhofs zutage, einige in unglasierten Wannensarkophage aus Ton eines Typs, der bereits aus der neuassyrischen Zeit bekannt ist. Manch weisen deutliche Reparaturspuren auf; das deuten darauf hin, dass in der parthischen Zeit alte Sarkophage wiederverwendet wurden, wie bereits Walter Andrae vermutet hatte. Der Friedhof wurde in der Antike geplündert, und die Grabräuber ließen dabei zwei große Wasserkrüge zurück. Die Plünderung kann aufgrund ihrer charakteristische Bienenwabenverzierung ins 8. Jahrhundert n. Chr. und die frühislamischen Zeit datiert werden.
Wichtige Funde aus dem großen Gebäude A unterhalb dieses Friedhofs umfassen eine Bronzemünze, entweder von Antiochos VIII. (125–96 v. Chr.) oder seinem Sohn Antiochos XII. (87–83/82 v. Chr.), in jedem Fall ein spätseleukidisches Stück, und das Fragment einer importierten attischen Echinusschale, eine der beliebtesten Formen der hellenistischen Gefäßtypologie, deren nicht-lokaler Ursprung auch durch die chemische und petrographische Keramikanalyse bestätigt wird; beide Funde untermauern die hellenistische Datierung von Gebäude A. „Raum 5“ der irakischen Ausgrabungen von 2002 erwies sich als tiefliegender Getreidesilo von Gebäude A. Die Flotationsproben lieferten weiteres Material für die laufende Pflanzenbestimmung, darunter die neu identifizierte Wildpflanze Astragalus sp. (Tragant).
Im Schnitt NT1 wurde auch ein neuer Raum des riesigen neuassyrischen Gebäudes B ausgegraben, der als Empfangsraum identifiziert werden kann. Er lieferte umfangreiches Flotationsmaterial, das weitere Radiokarbondatierungen ermöglichte und unser Wissen über die in Assur während der späten neuassyrischen Zeit genutzten Nutz- und Wildpflanzen vertieft.
Darüber hinaus nahmen wir im Tempelbezirk von Assur Sedimentproben durch Bohrungen in den Allerheiligsten der Heiligtümer der Götter Ischtar und Assur, um deren Baugeschichte zu beleuchten. Die Bohrungen lieferten zwar keine eindeutigen Ergebnisse für den Assur-Tempel, unter der Cella des Ischtar-Tempels stellten wir jedoch eine 1 m dicke Schicht nicht-lokalen Sandes fest, die direkt unter dem ersten Heiligtum der Frühdynastie abgelagert worden war. Die Verwendung des importierten Sandes diente wohl der rituellen Reinigung des Geländes.
Neben der detaillierten Darstellung der neuen Ausgrabungsergebnisse enthält der Band Kapitel zu den schlimmen Erosionsschäden der archäologischen Stätte, zu dem kombinierten Programm an Sedimentbohrungen und geophysikalischer Prospektion (im Jahr 2024 mit Schwerpunkt auf der Erdwiderstandstomografie = ERT), zu den typologischen, chemischen und petrografischen Analysen an der Keramik verschiedener Perioden, zu den Kleinfunden und den Keilschrifttexten (größtenteils beschriftete Ziegel von der Oberfläche), zu den Ziegelrezepten aus unterschiedlichen Epochen auf der Grundlage ihrer geochemischen Analyse, zu den menschlichen Überresten sowie zur antiken Pflanzenwelt und -verwendung auf der Grundlage der Analyse von Holzkohlen, Flotationsleichtfraktionen und Phytholithen.
Format: 30 x 21 cm — Hardcover
Umfang: 240 Seiten, mehr als 260 meist farbige Abbildungen
ISBN: 978-3-935012-70-6
Preis: 59,00 €
© PeWe-Verlag 2025

